15. April 2022
Das Degrowth-Dilemma
Wer Verzicht predigt statt die Wirtschaft umbauen zu wollen, schickt die Klimabewegung ins Leere.
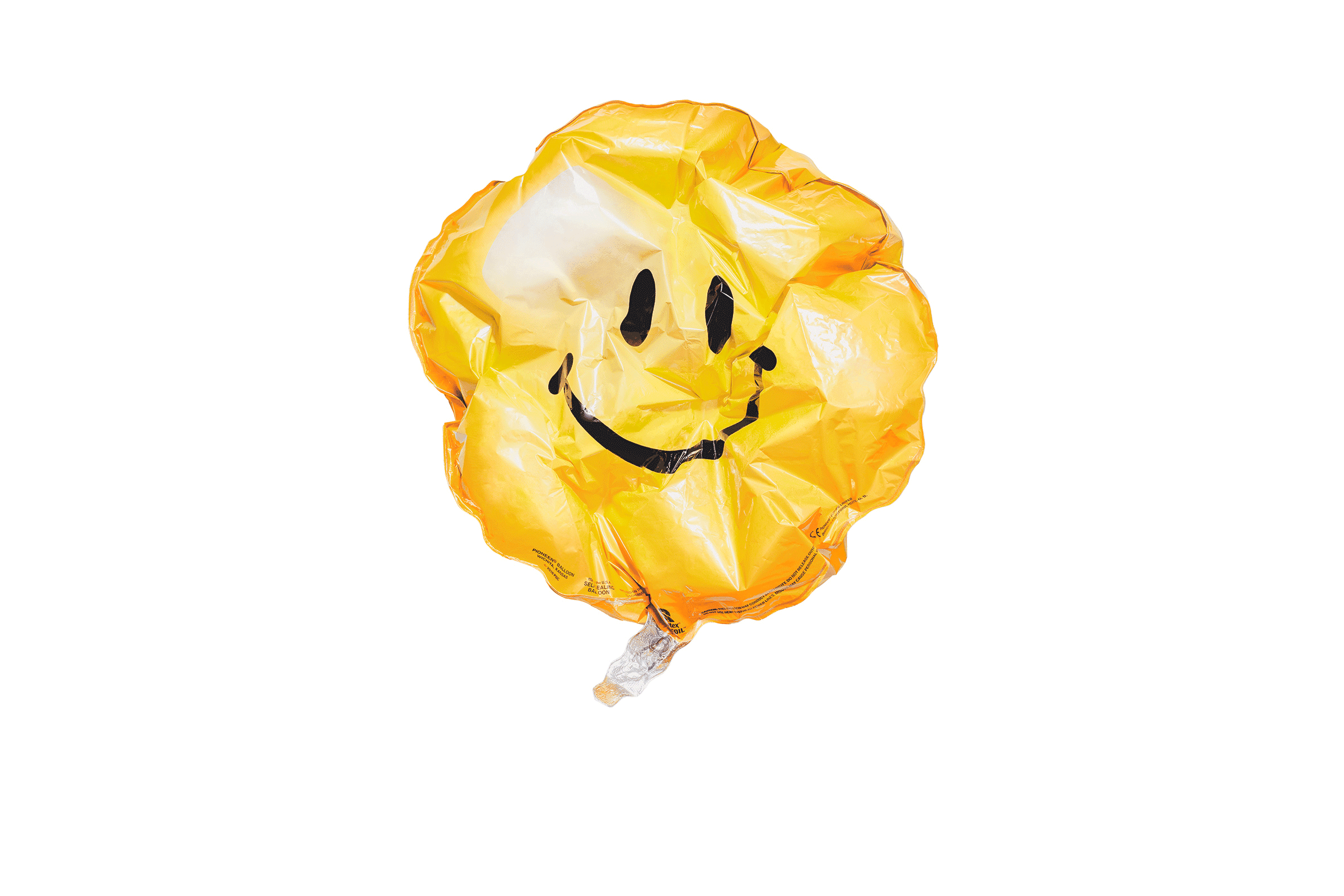
Die Grundlagen für unser Leben auf der Erde sind begrenzt. Dass unbegrenztes Wachstum nicht möglich ist, sofern die Menschheit an ihrer Existenz hängt, ergibt sich daraus als logische Konsequenz. Das war schon 1972 die klare Botschaft des Club of Rome. Seither sind die »Grenzen des Wachstums« zum geflügelten Wort geworden und es mangelt nicht an Abkommen und Konventionen in ihrem Geiste. Eine nüchterne Analyse zeigt jedoch, dass es nicht gelungen ist, Wachstum und Nachhaltigkeit zu vereinen.
Die Hoffnung, durch »Grünes Wachstum« oder technische Innovation den Ressourcenverbrauch vom Wachstum zu entkoppeln, hat sich in der Praxis als illusorisch erwiesen. Technologie ist nicht neutral, sondern in Wesen und Wirken eng verwoben mit der Gesellschaft, die sie hervorbringt und anwendet. Wenn Effizienzsteigerungen dazu führen, dass die Waren günstiger werden und dadurch ihr Gesamtvolumen wachsen muss, damit die Profite weiter steigen können, beißt sich die Katze in den Schwanz. Dieser Rebound-Effekt macht es unmöglich, unter kapitalistischen Bedingungen den Energie- und Rohstoffverbrauch absolut zu reduzieren, während die Wirtschaft weiter wächst.
Wer deshalb auf Suffizienz setzt, also die absolute Reduktion des Ressourcenverbrauchs, hat zunächst einmal gute Argumente auf seiner Seite. Zumindest aus ökologischer Perspektive spricht vieles dafür, auf einige Konsumprodukte gänzlich zu verzichten, bestimmte Produktionszweige abzuwickeln oder wenigstens rückzubauen und neue Großinfrastrukturprojekte darauf abzuklopfen, ob diese nicht mehr schaden als nutzen. Neben der Energiegewinnung aus fossilen Trägern müsste vor allem die chemische Industrie reduziert werden, was auf eine deutliche Verringerung der Kunststoff-, Düngemittel- und Pflanzengiftproduktion hinausliefe.
Angesichts der fortgesetzten ökologischen Verwerfungen ist es kein Wunder, dass sich die Wachstumskritik derzeit wieder wachsender Beliebtheit erfreut. Dies gilt besonders für die Debatte über Postwachstum – so die gängigste Übersetzung von degrowth beziehungsweise décroissance –, die sich seit den 2000er Jahren international entwickelt hat. Der Postwachstums-Ansatz hat einige wichtige Aspekte zu progressiver Gesellschaftskritik beitragen. Dabei ist er jedoch insgesamt sehr heterogen und oft widersprüchlich geblieben. Vor allem sind die dem Wachstum zugrundeliegenden gesellschaftlichen Mechanismen in den meisten Fällen nur unzureichend geklärt. Das Ergebnis sind dann oft diffuse Vorstellungen bezüglich politischer Strategie sowie der Frage, wie eine Postwachstumsgesellschaft aussehen könnte.
Die Säulenheiligen des Postwachstums
Im deutschsprachigen Raum ist diese Debatte vor allem mit den Namen Niko Paech und Maja Göpel verbunden. In ihren Arbeiten kommen die Mängel des Postwachstums-Ansatzes besonders deutlich zum Vorschein. Dennoch lohnt sich die Auseinandersetzung mit ihnen – allein deshalb, weil sie in der jungen Klimabewegung eine unheimliche Popularität genießen. Zwar schlagen Paech und Göpel bezüglich der politischen Orientierung beinahe konträre Wege vor, jedoch eint sie ihr Fokus auf das Denken und Handeln der Individuen, der den Blick auf die gesellschaftlichen Strukturen und Mechanismen verstellt.

Dieser Artikel ist nur mit Abo zugänglich. Logge Dich ein oder bestelle ein Abo.
Du hast ein Abo, aber hast dich noch nicht registriert oder dein Passwort vergessen?
Klicke hier!
Christian Hofmann veröffentlichte 2022 gemeinsam mit Philip Broisted die Edition »Linke Klassiker« zum Thema »PLANWIRTSCHAFT: Staatssozialismus, Arbeitszeitrechnung, Ökologie« sowie 2020 »Goodbye Kapital« im PapyRossa-Verlag.