02. Mai 2022
Hoffnung und Frust in Grünheide
Für die einen ein Glücksfall, für die anderen eine Katastrophe: Der Konflikt um die Tesla-Niederlassung in Grünheide beweist, warum eine Allianz aus Gewerkschaften und Umweltverbänden so dringend notwendig ist. Ein Ortsbesuch.

Manuela Hoyer in der Nähe des Dorfbahnhofs.
Manuela Hoyer steht an der Schranke des kleinen Dorfbahnhofs »Fangschleuse«. Ihre grauen Haare sind kurz geschnitten, eine rote Sonnenbrille sitzt auf ihrer Nase – es ist warm hier zwischen den Kieferbäumen, die für diese Region so typisch sind. Zwischen dem Bahnhof unweit der Ortsgrenze von Grünheide und dem »Verbrechen«, wie sie es bezeichnet, liegen nur ein paar Minuten Fußweg. Diese Strecke sei sie schon viel zu oft gelaufen, obwohl sie sie mittlerweile eigentlich lieber meiden würde.
Es geht um die Verlegung des Bahnhofs, die Taktung der Züge, den neuen Parkplatz, gerodete Waldstrecken, Lebensräume von Zauneidechsen und Schlingnattern, erzählt die 62-Jährige. Ein roter Linienbus fährt die Hauptstraße entlang. Frau Hoyer merkt an, dass auf der Anzeige nun keine Streckennummer mehr leuchtet, sondern nur noch ein Wort: Tesla.
Die Niederlassung des amerikanischen E-Mobilitätsunternehmen in Grünheide hat ihr Leben grundlegend verändert – und nicht zum Guten, meint die ehemalige Gewerkschaftsmitarbeiterin. Vor über zwanzig Jahren zog die Berlinerin hierher. »36 Jahre hab ich direkt an Berliner Hauptverkehrsadern gelebt. Als ich meine erste Nacht hier draußen verbracht hab, konnte ich nicht pennen, weil es so still war. Aber danach war mir klar: Ich geh nie wieder zurück nach Berlin. Ich genieße diese Ruhe viel zu sehr.« Bis heute lebt sie mit ihrer Frau hier, doch mit der Ruhe, für die sie einst hergezogen sind, ist in der Gemeinde Grünheide nun Schluss.
Immer wieder spricht sie von »diesem Bürgermeister« als einem der Verantwortlichen. Gemeint ist der parteilose Arne Christiani. Seit knapp zwanzig Jahren sitzt er im Rathaus Grünheide und feilt an einem Plan, der nun aufzugehen scheint. Christiani wirkt energisch, spricht schnell. »Anfang der 2000er haben wir gesagt: Lasst uns solche Bedingungen schaffen, dass kein Großinvestor an der Gemeinde Grünheide vorbeikommt.« Ein Teil dieses Plans waren Strukturmaßnahmen wie Bildungseinrichtungen, Fahrradwege und eine gute Anbindung. Noch wichtiger jedoch war die Kennzeichnung des Waldstücks im Ortsteil Freienbrink als Industriefläche. Christiani wartet schon seit Jahre darauf, dass sich hier ein großes Unternehmen ansiedelt. BMW war einer der Interessenten, dann kam Tesla – und griff zu. Rund 41 Millionen Euro zahlte der Konzern vor drei Jahren für die 300 Hektar Land.
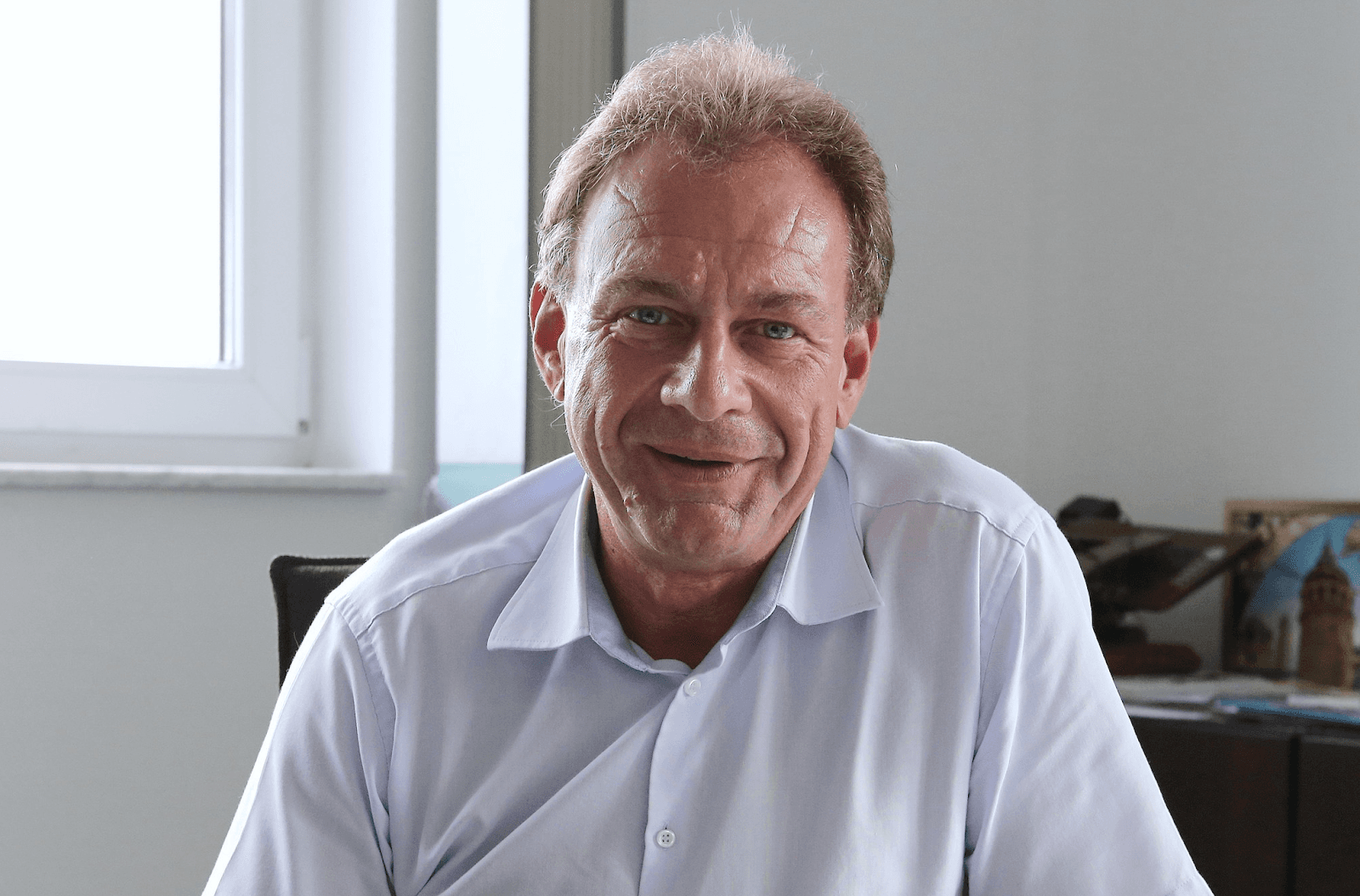
Bürgermeister Arne Christiani, Foto: Gemeinde Grünheide (Mark)
Im November 2019, als Elon Musk und der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke ankündigten, dass die neue Gigafactory des Autoherstellers in Grünheide eröffnen würde, begann dort eine neue Zeitrechnung. Wo Manuela Hoyer früher durch den Wald spazierte, rollen seither täglich Baumaschinen durchs Gehölz. »Hier überall war Wald«, sagt die 62-Jährige leise, während ihr Blick über das gigantische Fabrikgelände schweift, das nun zu ihrer Nachbarschaft zählt. Die gerodeten Flächen werden laut Tesla an anderer Stelle wieder aufgeforstet, doch ihren Wald bekommt Manuela Hoyer nicht zurück. Auch deswegen gründete sie 2019 mit einigen anderen Anwohnerinnen und Anwohnern die Bürgerinitiative Grünheide und setzt sich seitdem gegen die Produktion von Elektroautos in Brandenburg ein. Seitdem Tesla am 22. März 2022 seine Eröffnung feierte, hat sich bei ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern jedoch ein Gefühl der Ohnmacht eingestellt.
Ganz anders sieht das Arne Christiani. Die Fabrik sei ein Glücksfall, sagt er. »Es geht mir darum, jungen Menschen eine Perspektive bieten zu können. Normalerweise gehen die meisten nach der Schule hier weg, das wird sich ändern.« Trotzdem werde aus Grünheide kein neues Wolfsburg, denn in Grünheide könnten maximal 12.500 Einwohnerinnen und Einwohner leben, meint der Bürgermeister. Er rechnet mit 40.000 Beschäftigten, die irgendwann im Tesla-Werk arbeiten werden. Das »Landesplanerische Konzept zur Entwicklung des Umfeldes der Tesla-Gigafactory«, welches vom Land Brandenburg entworfen wurde, geht davon aus, dass rund 40 Prozent dieser Arbeitskräfte in Berlin leben werden, einige weitere in Frankfurt (Oder) und dem brandenburgischen Umland. Nur etwa 5.500 Mitarbeitende werden voraussichtlich im engeren Umkreis der Fabrik wohnen.
Die meisten Menschen in Grünheide seien glücklich über die Ansiedlung des Tesla-Werks, meint Christiani. Dafür spricht auch eine Umfrage des Tagesspiegels. Rund 71 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger hatten die Niederlassung des Autobauers positiv bewertet. Manuela Hoyer hat aus deswegen nicht nur die Hoffnung in die Lokalpolitik verloren, sondern auch den Glauben an ihre Dorfgemeinschaft. Ihre Rolle als mahnende Stimme des Ortes hat sie isoliert. »Die Gemeinde ist gespalten. Viele im Dorf haben aufgehört, mich zu grüßen. Die Menschen hier haben die Tragweite dieser Geschichte nicht verstanden. Die werden erst begreifen, was hier passiert, wenn sie sich ihr Wasser im Supermarkt kaufen müssen.«
Die Frage nach dem Wasser schwingt in den Diskussionen um die Gigafactory immer mit. Die Trinkwasserverordnung ist die letzte Hoffnung der Gegnerinnen und Gegner des Tesla-Werks. 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser soll die Fabrik im Jahr benötigen. Das entspricht etwa dem Verbrauch einer 40.000 Einwohnerstadt. Erschwerend kommt hinzu, dass Grünheide zu den trockensten und wärmsten Regionen des Landes gehört. Unweit der Gigafactory in der Gemeinde Neuenhagen hatte die Wasserfrage schon einmal der Ansiedlung eines Unternehmens einen Strich durch die Rechnung gemacht. Google wollte dort ursprünglich ein Rechenzentrum bauen. Doch die Kapazitäten des Wasserverbands Strausberg-Erkner reichten für die Versorgung nicht aus.
Auch gegen die Wasserspeisung des Tesla-Werks versuchen Umweltverbände vorzugehen. Doch Arne Christiani meint: »Wenn man den Wasserverbrauch in Relation zur Beschäftigtenzahl setzt, sieht es hier deutlich besser aus als damals bei Google. Und die Knappheit betrifft nicht die ganze Region. Der Wasserverband Fürstenwalde hat beispielsweise keine Lieferprobleme.« Trotzdem wurde das Wasserkontingent für Privathaushalte vom Wasserverband Strausberg-Erkner, der auch das Tesla-Werk versorgt, auf 100 Liter pro Tag gedeckelt. Die Sorge vor der nächsten Dürreperiode bleibt.
Auch die vielen Arbeiterinnen und Arbeiter, die in Tesla-Werksbekleidung am Bahnhof Fangschleuse ankommen und abfahren, hoffen, dass die Versorgung des Werkes reibungslos abläuft. Unter ihnen ist auch ein eleganter junger Mann in grauem Anzug mit akkurat geschnittenem Haar. Sein Blick geht suchend den Bahnsteig auf und ab. Tarek* sei sein Name und er halte Ausschau nach seinem Kumpel, meint er mit einem freundlichen Lächeln. Beide haben an diesem Tag ihr Bewerbungsgespräch beim amerikanischen Autobauer.
»Ich habe viel über Tesla gelesen, klar da bin ich informiert«, sagt er. Dass es ein richtiges Bewerbungsgespräch gebe, sei dem ausgebildeten Elektrotechniker trotzdem neu. »Ich habe jahrelang bei VW in der Produktion gearbeitet. In Niedersachen und Sachsen. Da habe ich einfach angerufen und später hieß es: Okay, du fängst am Dienstag an.« 3.000 Euro brutto bekam er beim deutschen Autohersteller. Gutes Geld. Er war zufrieden. Doch während der Pandemie wurden große Teile der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt. Für Tarek war es ganz aus. »Als sie mir gekündigt haben, meinten sie, dass ich wieder anfangen könne, sobald sich die Situation stabilisiert. Aber dann kam auch noch der Krieg in der Ukraine.«
Viele der neuen Arbeiterinnen und Arbeiter im Tesla-Werk waren vorher schon bei anderen Autoherstellern in Deutschland angestellt. Sie versprechen sich hier eine bessere Beschäftigungssicherheit als bei VW, Audi oder BMW, denn Tesla baut auf dem Gelände auch eine Batteriefabrik und eine Lackiererei. Für Manuela Hoyer ist das alles eine Katastrophe aufgrund der chemischen Abfälle, die ins Grundwasser gelangen könnten, für Tarek hingegen ein Stabilitätsfaktor. Vieles soll direkt vor Ort gefertigt werden, aus einem Guss sozusagen. Produktionsausfälle, Lieferengpässe und damit einhergehende Kündigungswellen wie bei VW würden dadurch weniger wahrscheinlich, hofft der junge Elektrotechniker.
Laut der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) liegt die niedrigste Gehaltsstufe bei 2.700 Euro brutto und damit etwas über dem Durchschnitt im untersten Lohnsegment der Automobilbranche. Manuela Hoyer kann dem wenig Gutes abgewinnen. Der Konzern versuche bewusst, andere Faktoren wie schlechte Arbeitsbedingungen oder mangelnde betriebliche Mitbestimmung durch die vergleichsweise hohen Gehaltszahlungen zu kaschieren. »Als ehemalige Gewerkschaftsmitarbeiterin, blutet mir da das Herz«, sagt sie. Trotzdem habe sie bisher keinen Kontakt zu Arbeiterinnen und Arbeitern aus dem Werk aufgenommen.

Anwohnerin Manuela Hoyer vor gerodeten Waldflächen in Grünheide.
Der Konzern hatte die Betriebsratswahl kurzfristig für den 28. Februar 2022 angesetzt. Da allerdings nur Mitarbeitende wahlberechtigt sind, die bereits sechs Monate im Werk arbeiten und die Produktion zu diesem Zeitpunkt noch nicht lief, nahmen keine Beschäftigten aus der Produktion an der Stimmabgabe teil. In der Konsequenz gewann eine Liste, die dem Management sehr nahe steht. Für Bürgermeister Arne Christiani ist das kein Problem. Auf die Frage, ob er sich für die Arbeitsbedingungen in seiner Gemeinde verantwortlich fühle, meint der 62-Jährige: »Ich bin kein Gewerkschafter. Außerhalb der Werktore trage ich die Verantwortung. Im Werk nicht.«
Ob sie nach ihren Erfahrungen bei der Gewerkschaft und in der Bürgerinitiative selbst einmal in die parlamentarische Politik wolle? Hoyer schnaubt: »Niemals! Wenn man in die Politik geht, ist man verbrannt«, sagt sie. »Wenn es ein paar mehr wie mich gäbe – Eine richtige Masse – dann schon. Aber so geh’ ich dabei nur kaputt. Ich muss ja jetzt schon aufpassen, dass ich keinen Herzinfarkt kriege.«
Viele glauben, der Elektroautobauer Tesla habe die klimafreundlichen Industriegeschichte nach vorne gebracht. Die Politikwissenschaftlerin Thea Riofrancos hingegen hält das für eine Fehleinschätzung. »Eine zukünftige Welt, in der jedes Individuum ein Elektroauto besitzt, wäre eine Welt mit einer zerstörten Umwelt wegen dem, was es braucht, um ein Elektroauto zu produzieren«, sagt sie in einem Interview. Der Meinung ist auch Hoyer. »Wer ein Elektroauto als Grün bezeichnet, ist ein Verbrecher. Wenn man schon klimafreundliche Mobilität möchte, dann hätte man vor Jahren damit anfangen müssen, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen«, schimpft sie.
Diese Erkenntnisse mögen stimmen, aber sie zählen in Grünheide wenig. Um den Kampf gegen die Klimakrise geht es hier den wenigsten. Was hier zählt, ist die Verbesserung der Lebensumstände – und die möchte man lieber heute als morgen. Wo Löcknitz und Spree durchs Land ziehen, tritt ein bekanntes Dilemma zutage: Klimapolitik und Umweltschutz werden erst zu realistischen Alternativen, wenn Menschen die Möglichkeit bekommen, sich für sie zu entscheiden. Und das geht nur, wenn man ihnen gute Arbeitsbedingungen und eine sichere Lebensgrundlage garantiert. Auch in Grünheide.
In der Gigafactory wird das Dilemma von Klima und Arbeit nicht aufgelöst. Umso wichtiger ist es, dass Gewerkschaften und Umweltverbände zusammenarbeiten. Die Allianzen von IG Metall und dem BUND oder Ver.di und Fridays for Future machen Hoffnung, doch sie müssen auch umgesetzt werden und dürfen nicht zu einer bloßen PR-Strategie verkommen. Grünheide wäre ein vortrefflicher Ort für den Praxistest für diese »neuen Allianzen«.
*Name von der Redaktion geändert.