08. Dezember 2022
Kulturkämpfe kann man nicht gewinnen
Die zahnlose Identitätspolitik der letzten Jahre und das Erstarken der Rechten sind zwei Symptome derselben Krise.
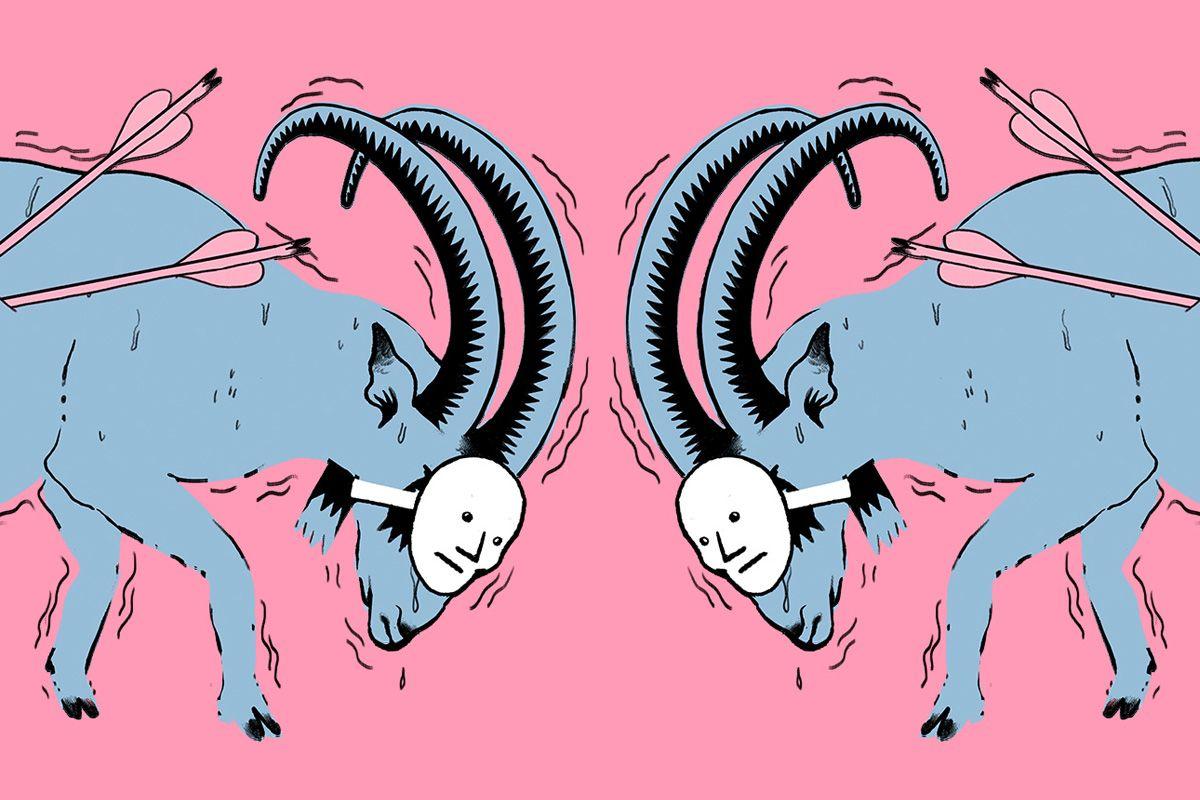
Das Problem mit der Identitätspolitik ist also, dass sie vorgab, die Linke zu erneuern, tatsächlich aber vielmehr den Neoliberalismus erneuerte.
Eine EU-Kommissarin gratuliert einer Mussolini-Verehrerin zum Amtsantritt als Premierministerin, weil sie die erste Frau auf dem Posten ist. Ein Ex-Springer-Chef ist überzeugt, dass eine öffentlich-rechtliche Comic-Maus die Kinder dieses Landes in die Transsexualität zwingen will. Im Bundestag fordert ein Rechter eine »Willkommenskultur für ungeborene Kinder«. Die grotesken Kulturkämpfe unserer Gegenwart sind wie ein schmerzhaftes Schrillen, das von Jahr zu Jahr lauter wird. »Deutschland. Aber normal« – der AfD-Slogan zur Bundestagswahl bringt das Narrativ der Rechten in diesen Auseinandersetzungen auf den Punkt. Fleisch essen, Winnetou gucken und ohne Limit über die Autobahn heizen – all das muss gegen »woke« Eliten verteidigt werden.
Im Zentrum dieser Debatten stehen nicht politische oder wirtschaftliche Fragen, an denen sich die Sphäre der Politik einst in Links und Rechts spaltete, sondern Fragen des Lebensstils, die unter dem Schlagwort »Kultur« gefasst werden. Dass genau um solche Fragen gekämpft wird, ist an sich kein sonderlich neues Phänomen. Über Sexualität, Religion oder Kunstfreiheit wurde auch in den 1950er und 60er Jahren erbittert gestritten. Kaum jemand erinnert sich heute etwa an den katholischen Volkswartbund, der Bücher und Filme auf »unsittliche« Inhalte untersuchte und mit staatlichen Behörden zusammenarbeitete.

Dieser Artikel ist nur mit Abo zugänglich. Logge Dich ein oder bestelle ein Abo.
Du hast ein Abo, aber hast dich noch nicht registriert oder dein Passwort vergessen?
Klicke hier!
Astrid Zimmermann ist Contributing Editor bei Jacobin.