04. April 2021
Der Weg der Brötchen in den Sozialismus
Ronald M. Schernikau hatte drei Ziele: schwul sein, Schriftsteller sein, Kommunist sein. Erreicht hat er sie alle. Diese Reportage über die ostdeutschen Brötchen von 1986 zeigt so konkret wie humorvoll, mit welchen Problemen die DDR-Wirtschaft zu kämpfen hatte.
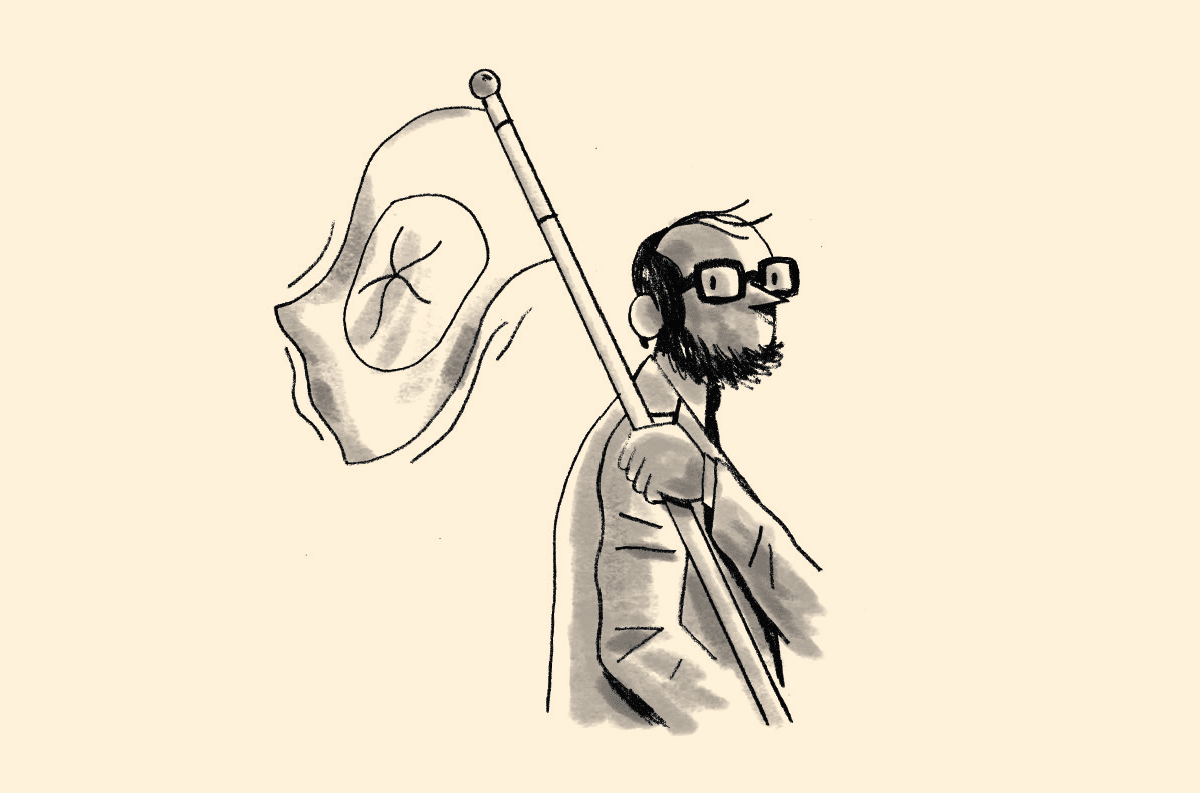
»Das Essen kommt aus der nahegelegenen Stahlgießerei, man bezahlt 85 Pfennig, es kostet 3 Mark 16. Auch das bezahlt der Kultur- und Sozialfonds.«
Es war einmal ein junger Mann, der fuhr in das schönste Land der Welt. So sehr viel Schönes hatte er aus diesem Land gehört, daß es fast unmöglich schien, noch Neues oder auch nur Erwähnenswertes hinzuzufügen. Aber der junge Mann war sehr entschlossen, es zu tun.
Um nicht mit dem Schwersten anzufangen, um über alles alles sagen zu können, will der junge Mann über Brötchen schreiben: In der DDR ist es nämlich so: Die Hälfte der Brötchen wird in staatlichen und Konsumbäckereien, die andere Hälfte in genossenschaftlichen und privaten Bäckereien gemacht. Die staatlichen schmecken nach Pappe, und die privaten kriegt man nicht. Das Thema also: Der Weg der Brötchen in den Sozialismus.
Als ich ankomme, regnet es. Vom Zug aus der Dom überragt die Stadt. Magdeburg sieht nicht gerade aus wie der aufregendste Ort der Welt: viele Neubauten, ein Meer von Antennen nach Westen hin, die älteren Häuser sehr groß und häuserfarbig.
Magdeburg wird im bisher letzten Weltkrieg zu neun Zehnteln zerstört. Das ungeheure Wohnungsbauprogramm löst die Probleme; Schönheit kommt später. Magdeburg hat viel Schwerindustrie und eine technische Hochschule.
Das Zentrum ist groß und hell im Stil der fünfziger und in dem der sechziger Jahre, alles ganz großzügig: Platz hatten sie ja. Ich soll mich bei einem Herrn Meinecke melden. Er geht mit mir zum Gästehaus des Rates des Bezirkes Magdeburg; sehr nobel alles. Hier triff sich auch die deutsch-deutsche Grenzkommission. Ich bade jeden Tag. Mein Zimmer ist ein Appartement, in ihm empfangen wir Jürgen Klinke.
Jürgen Klinke ist beim Rat des Bezirkes zuständig für die Getränke- und Backwarenversorgung der zwei Millionen Einwohner. Er ist Mitte vierzig, dicklich, sehr freundlich und offen. Er hat Konditor gelernt, wurde von seinem Betrieb zum Studium delegiert, ist Ingenieur für Ökonomie, arbeitet schließlich beim Staat. Wie man das wird? Man muß es können, sagt er. Man darf keine Westverwandtschaft haben, und vor allem muß man noch mal zur Schule gehen, zur Parteischule. Jetzt ist er Diplomstaatswissenschaftler. Wenn alles gutgeht, denkt keiner an mich. Wenn irgendwo eine Stunde die Produktion ausfällt, werde ich angerufen.

Dieser Artikel ist nur mit Abo zugänglich. Logge Dich ein oder bestelle ein Abo.
Du hast ein Abo, aber hast dich noch nicht registriert oder dein Passwort vergessen?
Klicke hier!